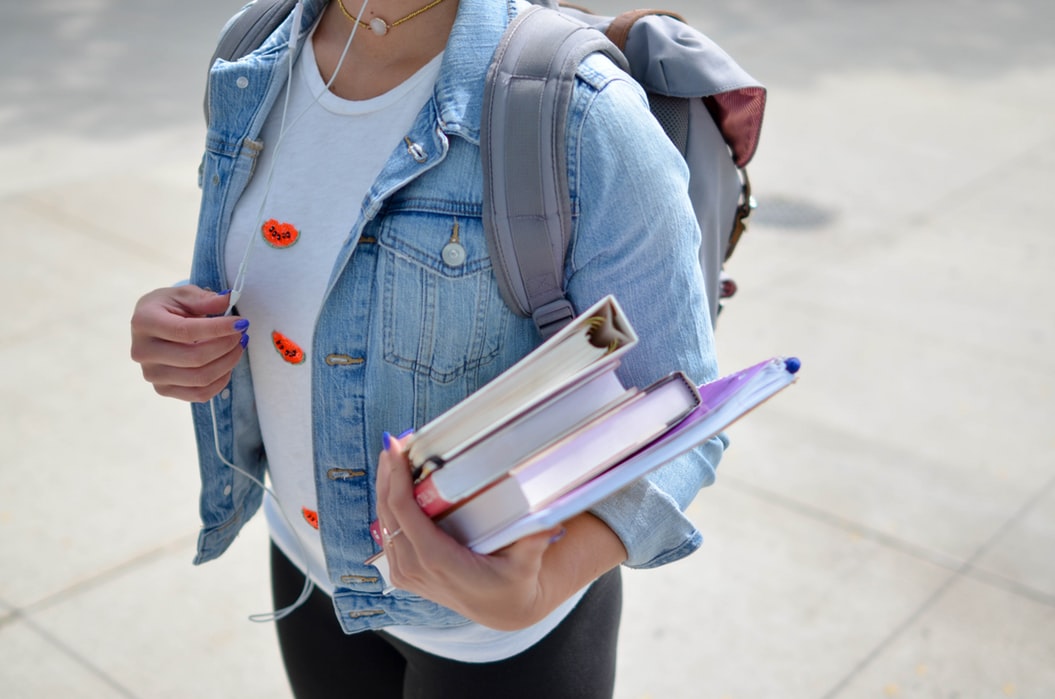Wenn uns das Internet überlebt
Was passiert mit deinem Instagram-, TikTok- oder Snapchat-Profil, wenn du nicht mehr auf der Welt bist? Diese Frage klingt zunächst weit hergeholt und fern, betrifft aber schon heute Milliarden von Accounts und Menschen. Posthume Accounts sind längst Teil von unserem digitalen Erbe. Während einige Profile nach dem Tod einer Person gelöscht werden, bleiben andere als Erinnerungsseiten bestehen. So wird das Netz zunehmend zu einem Ort, an dem digitale Geister weiterleben.
Posthume Accounts („tote Profile“) sind digitale Konten von verstorbenen Menschen. Im Zusammenhang mit dem Wort schwingt auch die Frage nach deren Verwaltung mit.
Wie viele tote Accounts gibt es?
Die Zahlen sind schon jetzt gigantisch: 2025 nutzen weltweit rund 5,4 Milliarden Menschen soziale Netzwerke – das sind fast zwei Drittel der Weltbevölkerung. Jede Person ist im Schnitt auf sechs bis sieben Plattformen aktiv.
Schätzungen zufolge könnten bis 2100 allein auf Facebook über 659 Millionen posthume Accounts, also tote Profile, existieren. In den USA wird erwartet, dass in den nächsten Jahren die Zahl der verstorbenen Nutzer*innen die der Lebenden übersteigt. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich auch in Europa und Asien, aber erst Jahrzehnte später.
Die Künstliche Intelligenz: Zwischen Erinnerung und Algorithmus
Diese Profile sind mehr als unheimliche Überreste, es sind digitale Identitäten. Sie sind digitale Erinnerungsorte und kulturelle Archive, die zeigen, wie Menschen gelebt haben, dachten und kommunizierten. Doch sie werfen schwierige Fragen auf:
Wer kontrolliert die Daten? Wer darf sie löschen, verwalten oder weiterführen? Familienangehörige? Plattformen? Niemand?
Zugleich verschwimmt die Grenze zwischen Leben und Tod. Künstliche Intelligenz kann heute bereits Stimmen und Schreibstile imitieren – theoretisch lässt sich ein vollständiger Zwilling eines Verstorbenen generieren. Dies ist das Fachgebiet der sogenannten Grief-Tech-industrie.

Wenn Tote wieder lebendig werden
Angehörige können dann mit diesem digitalen Avatar kommunizieren und interagieren: Die vermeintlich letzte Begegnung mit den Verstorbenen nachholen. Umso besser die Rekonstruktion der Person, also umso mehr Daten der Künstlichen Intelligenz zur Verfügung stehen, desto realer das Erlebnis.
Diese neue Möglichkeit des Abschieds kann aber auch zu psychologischen Problemen führen. Durch die ständige Verfügbarkeit einer digitalen Kopie kann die Technologie sich wie zu einer Art Droge nach Nähe zu dem Verstorbenen entwickeln. Außerdem darf man nie vergessen, dass eine Person nur nachgeahmt wird. Manche Dinge hätte eine verstorbene Person vielleicht nie selbstständig gesagt.
Wann wird Erinnerung zur Simulation – und ab wann verletzt sie die Würde oder das Persönlichkeitsrecht eines Menschen?
Der Gedenkzustand beschreibt den Zustand eines Accounts, in dem das Erstellen von neuen Beiträgen und Inhalten nicht mehr möglich ist, aber alte Beiträge und Inhalte noch erhalten bleiben. Interaktionen sind noch möglich.
Der Kontakt, der nach dem Tod einer Person über das Konto und alle Berechtigungen verfügt.
Der digitale Nachlass: Zwischen Gedenken und Gesetz
Große Plattformen reagieren unterschiedlich auf das Thema:
- Bei Facebook und Instagram können Angehörige oder Freund*innen ein Formular nutzen, um einen Todesfall zu melden. Mithilfe eines Nachweises kann daraufhin das Konto in einen Gedenkzustand versetzt werden oder gelöscht werden.
- Google LLC bietet den „Inaktivität-Manager“, mit dem vorab geregelt werden kann, was nach einer definierten Zeit der Inaktivität, also auch bei einem Todesfall, mit dem Konto passieren soll. Zur Möglichkeit stehen hierbei die allgemeine Löschung des Kontos und die Übertragung an einen Nachlasskontakt.
- Snapchat bietet keinerlei Möglichkeiten auf ein digitales Weiterleben, sondern nur die Löschung des Accounts nach Vorlage einer Sterbeurkunde durch Angehörige.
- Bei Pinterest ist die Löschung des Accounts nach Vorlage einer Sterbeurkunde durch Angehörige möglich.
- Für WhatsApp ist der Zugriff durch Hinterbliebene auch nicht vorgesehen. Hier besteht nur die Möglichkeit zur Löschung des Accounts, nach Vorlage einer Sterbeurkunde durch Angehörige. Alternativ wird ein Account nach 120 Tagen der Inaktivität automatisch gelöscht.
Parallel entstehen „Digital Afterlife Services“. Sie speichern Passwörter und letzte Wünsche, damit Angehörige wissen, was nach dem Tod passieren soll. Die digitale Nachlassplanung wird so zur modernen Form des Testaments.

Diese Gesetze gibt es zu posthumen Accounts
Juristisch bilden sich langsam auch die ersten Grundlagen:
- Israel hat 2025 das erste Gesetz für digitale Nachlässe verabschiedet – Nutzer*innen dürfen selbst bestimmen, wer nach ihrem Tod Zugriff auf ihre Konten und Daten hat.
- In Deutschland gelten Social-Media-Accounts bereits als Teil des Erbes – die Erben dürfen also übernehmen, was online bleibt.
- Die EU arbeitet am ELI-Modellrecht, das Datenschutz, Erbrecht und digitale Vermögenswerte vereinen soll.
Jurist*innen empfehlen ein persönliches Digital Legacy Register: eine Art Testament für Online-Konten, in dem man festlegt, welche Profile erhalten, gelöscht oder übertragen werden sollen. Ziel ist es, Struktur und Schutz vor Missbrauch zu schaffen – zu Lebzeiten.
Ein neues digitales Erbe
Unsere Generation ist die erste, deren digitale Spuren größer sind als die materiellen Dinge, die sie hinterlässt. Posthume Accounts verändern, wie wir trauern, erinnern und mit Identität umgehen. Sie zwingen uns über Verantwortung, Datenschutz und Selbstbestimmung nachzudenken – über den Tod hinaus.
Am Ende bleibt eine persönliche Frage: Willst du wirklich, dass dein letzter Post dein Vermächtnis ist?
Artikel vom 07.11.2025.